Navigieren Sie sicher durch Komplexität und Dynamik. Mit über 20 Jahren Erfahrung und bewährten Methoden helfen wir Ihnen, Produkte schneller, effizienter und erfolgreicher zu entwickeln.
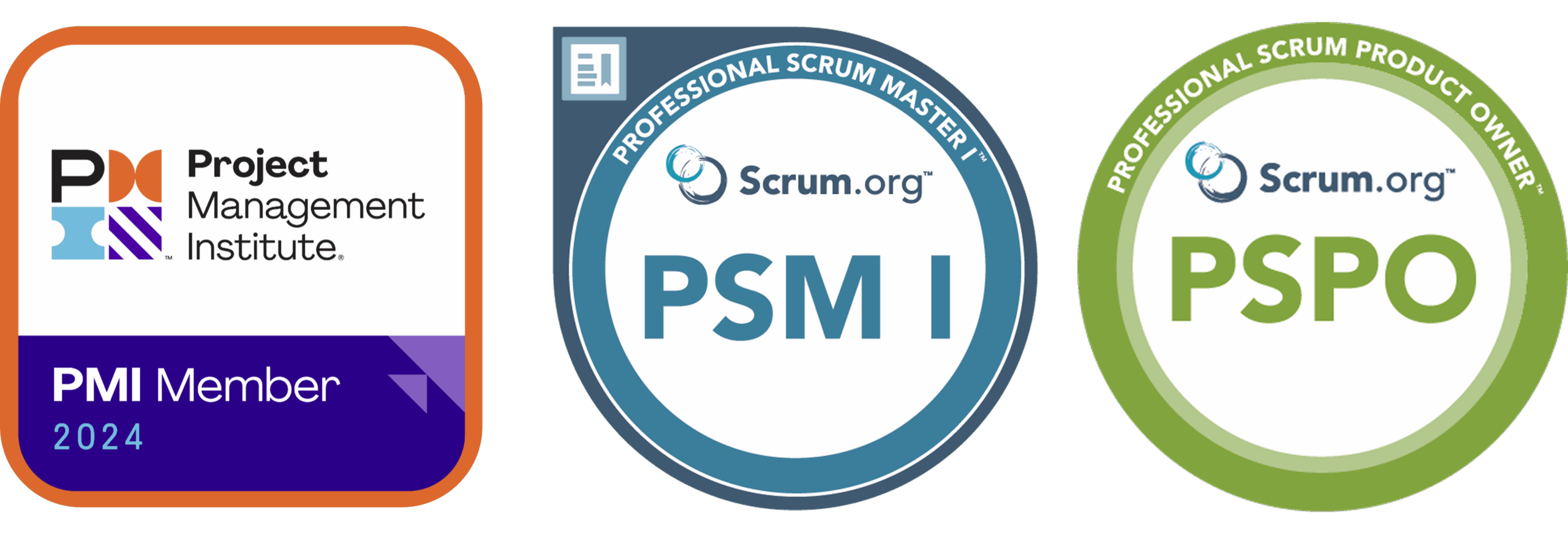
Experte & Autor mit 20+ Jahren Erfahrung

Als Experte für F&E, Produktentwicklung, Innovation und Projektmanagement und Autor des Fachbuchs "Kybernetisches Management von Projekten" bringe ich fundiertes Wissen und praktische Erfahrung zusammen.
Wir ermöglichen es unseren Kunden, ihre Produkte effizient und schnell zu größter Kundenzufriedenheit zu entwickeln. Wir unterstützen aktiv von der Strategie bis zur vollbrachten Umsetzung. Wir sichern den Entwicklungserfolg unserer Kunden.
3 einfache Fragen zu Ihrer aktuellen Situation
Profitieren Sie von bewährter Expertise und messbaren Erfolgen
Beschleunigte Produktentwicklung ohne Qualitätsverlust durch kybernetische Steuerungssysteme.
Über 20 Jahre Erfahrung und 30+ erfolgreiche Beratungsprojekte in verschiedensten Branchen.
PMP, PSM, PSPO und weitere Zertifikate garantieren Qualität auf höchstem Niveau.
Überzeugende Referenzen von führenden Unternehmen sprechen für sich.
Einzigartige Kombination aus agilen Frameworks und kybernetischer Systemtheorie.
Klare KPIs und nachweisbare Verbesserungen in Geschwindigkeit und Effizienz.
In 3 einfachen Schritten zu besseren Entwicklungsergebnissen
Wir analysieren Ihre aktuelle Situation und identifizieren Optimierungspotenziale in einem 30-minütigen Gespräch.
Sie erhalten ein individuelles Beratungskonzept, perfekt auf Ihre Anforderungen und Ziele abgestimmt.
Gemeinsam setzen wir die Maßnahmen um und Sie profitieren von messbaren Verbesserungen.
Vertrauen Sie auf international anerkannte Expertise

edX Professional Certificate

edX Professional Certificate
Das Standardwerk für komplexe Projekte
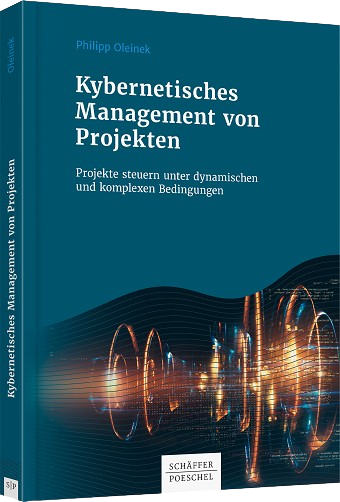
Das Buch beschreibt detailliert und praxisbezogen ein erprobtes Managementsystem, das auf hohe Dynamik und Komplexität ausgerichtet ist und schnelle Steuer- und Regelungsreaktionen ermöglicht.
Dabei werden Elemente aus dem klassischen Projektmanagement mit agilen Vorgehensmodellen zu einem eigenständigen, vollständig vernetzten System kombiniert, das auf den Grundlagen der Kybernetik basiert.
Überzeugende Ergebnisse sprechen für sich
"Herr Oleinek hat mein Projektteam bei der Erprobung agiler Methoden unterstützt. Er kann komplexe Inhalte klar vermitteln. Seine Methodenkompetenz ist exzellent."
"Herr Dr. Oleinek bringt ausgezeichnete Praxis- und Methodenerfahrung mit. Er fand stets systematische und pragmatische Lösungen."
"Dr. Oleinek hat sich als ausgewiesener Experte für die Verschlankung von Produktentwicklungsprozessen bewiesen. Seine Herangehensweise ist proaktiv."
Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen
Kybernetisches Projektmanagement eignet sich besonders für Unternehmen, die Produkte unter komplexen, dynamischen Umfeldbedingungen entwickeln und die auf eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ihrer Fachexperten angewiesen sind. Ideal für Branchen wie Automotive, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Medizintechnik und IT.
Der Begriff "Kybernetik" wurde 1948 von N. Wiener als "das ganze Gebiet der Regelung und Nachrichtentheorie" eingeführt. Auf die Produktentwicklung angewandt, behandelt sie die Frage, wie im Rahmen der Produktentwicklung gesteuert und kommuniziert wird, insbesondere unter komplexen und wenig vorhersagbaren Bedingungen.
Die erste 30-minütige Beratung ist kostenlos und unverbindlich. Danach erstellen wir ein individuelles Angebot basierend auf Ihren spezifischen Anforderungen.
Die Dauer variiert je nach Projektumfang. Typischerweise dauern Beratungsprojekte zwischen 3 und 12 Monaten. Wir passen uns flexibel Ihren Bedürfnissen an.
Ja, wir bieten sowohl Remote-Beratung als auch Vor-Ort-Unterstützung an. Die meisten Projekte kombinieren beides für optimale Flexibilität und Effektivität.
Wir kombinieren naturwissenschaftliche Expertise, persönliche Industrieerfahrung, umfassende Beratungserfahrung und ein kontinuierlich aktualisiertes Fachwissen mit kreativen Lösungen und einer partnerschaftlichen Umsetzung.
Buchen Sie jetzt Ihre kostenlose 30-minütige Erstberatung und erfahren Sie, wie kybernetisches Projektmanagement Ihre Produktentwicklung transformieren kann.
30 Minuten die Ihre Produktentwicklung transformieren können